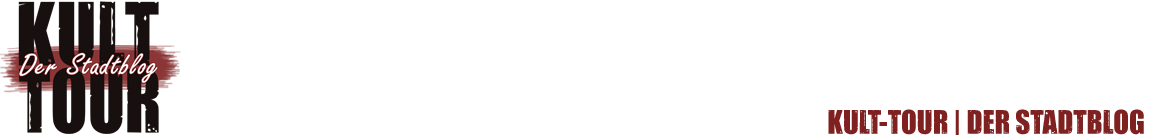Umjubelte „My Fair Lady“ mit Ecken und Kanten
Frenetischer Applaus am Ende der Premieren-Vorstellung am 24.01.2015 und vereinzelt stehende Ovationen sowie überdurchschnittliche viele „Vorhänge“ für alle Beteiligten! Regisseur und Operndirektor Philipp Kochheim gelang es, mit einer die Sparten Musik, Oper, Schauspiel übergreifenden Inszenierung von „My Fair Lady“ das Große Haus des Staatstheaters zu füllen, Glanz in die Stadt zu bringen, für Gesprächsstoff und Kontroversen zu sorgen, sowie Fragen offen zu lassen.
Text: Alkmini Laucke | Fotos: Marek Kruszewski
Intellektueller Zugang vonnöten?
Fragen und etwas Nörgelei, wie bei mir. Aber vielleicht nur deshalb, weil mir der intellektuelle Zugang fehlt? Macht euch am Besten ein eigenes Bild. Zunächst eine kurze Inhaltsangabe von der Originalfassung von „My Fair Lady“:
Die Handlung des Musicals von Frederic Loewe nach „Pygmalion“ von George Bernard Shaw spielt 1913. Professor Henry Higgins, ein Phonetiker, trifft nach einem Opernabend auf dem Marktplatz das Blumenmädchen Eliza, die ihn zunächst aufgrund ihrer vulgären Aussprache abstößt, jedoch auch gleichzeitig anzieht. Nach einer Wette mit seinem Freund Oberst Pickering, verspricht er ihr, innerhalb eines halben Jahres eine Dame aus ihr zu machen, sofern sie sich seinem Unterricht in seinem Sprachlabor unterzieht. Der Unterricht trägt trotz anfänglicher Schwierigkeiten Früchte. So wagt Higgins einen Versuch und begibt sich gemeinsam mit Eliza in die feine Gesellschaft beim Pferderennen in Ascot. Dieser Besuch endet durch Elizas Ausruf: „Lauf‘ schneller oder ick streu‘ dir Pfeffer in den Arsch!“ mit einem Skandal! Freddy Eynsford-Hill, ein Mann der feinen Gesellschaft, ist dennoch fasziniert von Eliza und verliebt sich unsterblich in sie. Higgins‘ Ehrgeiz bleibt ungebrochen und er arbeitet weiter mit seinem „Versuchsobjekt“. Beim Empfang in der Botschaft einige Zeit später bemerkt niemand Elizas Herkunft und Higgins feiert sich gemeinsam mit Pickering für diesen Erfolg. Eliza ist darauf zutiefst gekränkt und vertraut sich Higgins Mutter an, verlässt jedoch das Haus der Higgins‘. Nun wird auch Henry Higgins klar, dass er Eliza nicht nur vermisst, sondern auch schätzt und liebt. Eliza kehrt zu seiner Freude zu ihm zurück.
Als sich der Vorhang öffnete…
 Voller Neugier und Vorfreude auf einen unbeschwerten Musicalabend betrat ich in Begleitung meines Mannes pünktlich das Theater und nahm meinen Platz ein. Die Ouvertüre unter der Leitung Christopher Heins mit dem minimierten Staatsorchester klang vertraut und ging mir leicht ins Ohr. Dieses trug auch dazu bei, dass ich in den Umbaupausen mehr Vergnügen daran hatte, Christopher Hein während seines akkuraten Dirigats zu beobachten, als den auf den Vorhang projizierten U-Bahn-Plan zu studieren. Als sich der Vorhang öffnete, fand ich statt des Marktplatzes die Londoner U-Bahn Station Paddington als Kulisse vor.
Voller Neugier und Vorfreude auf einen unbeschwerten Musicalabend betrat ich in Begleitung meines Mannes pünktlich das Theater und nahm meinen Platz ein. Die Ouvertüre unter der Leitung Christopher Heins mit dem minimierten Staatsorchester klang vertraut und ging mir leicht ins Ohr. Dieses trug auch dazu bei, dass ich in den Umbaupausen mehr Vergnügen daran hatte, Christopher Hein während seines akkuraten Dirigats zu beobachten, als den auf den Vorhang projizierten U-Bahn-Plan zu studieren. Als sich der Vorhang öffnete, fand ich statt des Marktplatzes die Londoner U-Bahn Station Paddington als Kulisse vor.
…ließ Kochheim das Stück während des 2. Weltkrieges spielen
 Zu meiner Überraschung ließ Kochheim das Stück in London in den Monaten des 2. Weltkrieges unmittelbar vor dem Blitzkrieg spielen. Die Szene des Pferderennens in Ascot verlegte er nun hierfür folgerichtig in Mrs. Higgins noblen Salon, ein ausgesprochen herrschaftliches Bühnenbild (Thomas Gruber), in das später dann noch eine Granate krachen sollte. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Kriegsgeschehen bereits erfolgreich verdrängt und musste meinen Mann fragen, was das denn nun sollte. Seine geflüsterte Antwort “Es ist doch Krieg!“ holte mich wieder in Kochheims Interpretation zurück. Higgins selbst ließ er in einem mit Trödel und Antiquitäten überladenen Zimmer im Untergeschoss desselben Hauses leben und forschen. Zu guter Letzt erfolgte der größte Bruch mit der klassischen Version von „My Fair Lady“: Eliza kehrte nicht zu Higgins zurück! Das nenne ich mal einen:
Zu meiner Überraschung ließ Kochheim das Stück in London in den Monaten des 2. Weltkrieges unmittelbar vor dem Blitzkrieg spielen. Die Szene des Pferderennens in Ascot verlegte er nun hierfür folgerichtig in Mrs. Higgins noblen Salon, ein ausgesprochen herrschaftliches Bühnenbild (Thomas Gruber), in das später dann noch eine Granate krachen sollte. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Kriegsgeschehen bereits erfolgreich verdrängt und musste meinen Mann fragen, was das denn nun sollte. Seine geflüsterte Antwort “Es ist doch Krieg!“ holte mich wieder in Kochheims Interpretation zurück. Higgins selbst ließ er in einem mit Trödel und Antiquitäten überladenen Zimmer im Untergeschoss desselben Hauses leben und forschen. Zu guter Letzt erfolgte der größte Bruch mit der klassischen Version von „My Fair Lady“: Eliza kehrte nicht zu Higgins zurück! Das nenne ich mal einen:
Stilbruch
…von dem ich mich immer noch nicht erholt habe! Im Programmheft erklärt Kochheim, weshalb er die Handlung von 1913 in die Zeit des 2. Weltkriegs verlegte. Er zieht damit Parallelen zu einer Zeit kulturellen Verfalls. Dass er die Gegenwart ähnlich gefährdet sieht, erwähnt er ebenso. Allerdings befürchtete er diesbezüglich, dass er durch die konsequente Übertragung der klassischen Geschichte von My Fair Lady in die gegenwärtige Zeit eine Plattheit bewirkt hätte, die das Werk an sich hätte schädigen können. Aus meiner Sicht hat jedoch auch die Übertragung in die Zeit des 2. Weltkrieges dem Stück auch geschadet. Warum? Zunächst einmal möchte ich durchaus positiv bemerken, dass Kochheim auf spartenübergreifendes Miteinander setzt, was ich als sehr kreativ empfand und was mich emotional bewegte. Durch das Miteinander von Sängern und Schauspielern verlieh er den Figuren etwas Menschliches. Empfindlich störte mich jedoch der allzu offenkundige Bruch zwischen den Sparten. Ich habe in erster Linie ein Musical besucht, kein Schauspiel-Stück.
Wenn ein Andreas Bißmeier als Oberst Pickering mit knarrender Stimme sang, mit der er durch das Stück hindurch zu erheitern wusste, dann passte es. Schließlich hatte er nur einen Song zu singen. Tobias Beyer hingegen in der Rolle des Professor Higgins füllte seine Rolle zwar brillant aus, war aber durch den großen musikalischen Anteil überfordert. Einsatz und Intonation ließen unvermeidlich zu wünschen übrig, was er im Gesamtpaket durch sein Spiel zu kompensieren versuchte. Das gelang ihm sehr gut als ruppig-snobistischer bis menschenverachtender Professor, der auch weiche Züge andeuten durfte. Stimmlich hätte ich mir jedoch eher einen Bariton gewünscht. Das hoffnungslos überladene Bühnenbild und auch die an Pantomime anmutende Choreografie (Sean Stephens) waren für mich ein „Zuviel“ des Gut-Gemeinten.
Mirella Hagen als Eliza Doolittle schaffte stimmlich wohltuenden Ausgleich, sowohl in der Anfangsszene als flegelhaftes Mädel, als auch in ihrer Entwicklung zu jungen Frau. Sie ließ weder schauspielerisch noch stimmlich Wünsche offen. Sie führte ihren blühenden, hell gefärbten Sopran durch alle Gefühlsfacetten, stets sicher bis in die hohen Lagen. Szenenapplaus als sie in Robe (Mathilde Grebot) den Salon betrat und ihrer stimmlichen Anmut nochmals Ausdruck geben konnte.
Matthias Stier als Freddy Eynsford-Hill entschädigte. On Top! Er überzeugte als schmachtender Anwärter auf Elizas Hand. Sein Tenor drang schmelzend und sinnlich bis in die letzte Reihe des Zuschauerraums und das trotz vollem Körpereinsatz. Martina Struppek als lispelnde, „S- benachteiligte“ Mrs. Pearce wurde in dieser Inszenierung nicht um Eliza besorgt, sondern eher als subtil-intrigant dargestellt. Struppek verlieh der Figur einen sehr eigenen und originellen Charakter, welcher ausgesprochen gut beim Publikum ankam. Trotz Reflexion dieser Auslegung gefällt mir der mütterlich umsorgende Charakter einer klassischen Version dennoch einfach besser. An Moritz Dürr als Alfred P. Dolittle, Elizas bauernschlauer Vater, der einen charmanten Schnorrer darstellte, habe ich nichts auszusetzen. Ausdrucksstark und stimmlich ausgewogen füllte er seine Rolle aus. Philipp Georgopoulos konnte aufgrund der kleinen Rolle als Harry sein gesamtes Potenzial leider nicht entfalten. (Er ist derzeit in Maria de Buenos Aires zu erleben – Kult-Tour berichtete). Diese Inszenierung schaffte Raum für solistische Rollen der Chormitglieder, die durch das Hervortreten aus der Masse ihr Können unter Beweis stellen konnten.
Sonja Pallasch als Mrs. Eynsford-Hill gab in einer Sprechrolle eine überfürsorgliche Upper-Class-Mutter Freddys zum Besten. Malgorzata Przybysz als Mädchen, fiel äußerst angenehm auf. Hier war der Bruch zwischen den Sparten abermals deutlich: Pryzybysz erreichte mit ihrem warmen klaren Mezzo den Zuschauerraum bis in die letzte Reihe, womöglich auch noch ohne Verstärkung, war also in ihrer Nebenrolle als professionelle Sängerin deutlich zu erkennen. Zum Schreien komisch: Marcellus Mauch in einer kleinen Rolle als Churchill – besonders in der Pause unterhaltsam!
Aura, Glanz, Grande Dame Nadja Tiller
Mit Nadja Tiller als Mrs. Higgins hat Kochheim grandioses Geschick und ein Gefühl für die Defizite dieser Stadt bewiesen, die er jedenfalls mit dieser Besetzung großartig auszufüllen verstand. Nadia Tiller, die Grande Dame des Films und Schauspiels, erfüllte mit dieser Rolle höchste Ansprüche an die Schauspielkunst und Akzentuierung. Als sie auf der Bühne erschien, hätte man eine fallende Nadel selbst auf Teppich gehört. Oder, wie Kochheim es in einem Interview mit dem NDR treffend beschrieb: „Es gibt eine Sache, die glaube ich, kein Schauspieler der Welt herstellen kann, nämlich Aura.“
Der nächste geniale Paukenschlag
Kochheims Idee zur Pause: Er ließ die Szene des Empfangs im Casino in und durch das Foyer in die Pause münden. Dort mischten sich sodann Sänger und Schauspieler in das Publikum. Der gesamte Chor unter der Leitung von Georg Menskes hatte sichtlich Freude am gesamten Ablauf und erfüllte den musikalischen Anspruch im doppelten Sinne: spielend. Abschließend möchte ich euch nicht vorenthalten, was Nadja Tiller im Interview mit dem NDR über ihr Engagement am Staatstheater Braunschweig, bzw. über Philipp Kochheim zu sagen hatte:
„Ich konnte seinem Charme nicht widerstehen.“
Man darf sicher sein, dass sie nicht die Einzige bleiben wird. Diese Arbeit Kochheims war das, was Braunschweig schon lange brauchte. Ein durchdachtes Stück, zweifelsohne, jedoch wurde der Anspruch Kochheims, dieses nicht zu beschädigen, aus meiner Sicht leider nicht erfüllt. Das spartenübergreifende Denken ist in jedem Fall langfristig beizubehalten, belebt und bereichert es doch letztlich durch die verschiedenen Fertigkeiten. Die Begeisterungsbekundungen während und nach der Vorstellung dieser ausverkauften Premiere geben Kochheim Recht. Ich gehe davon aus, dass diese gelungene Darbietung längerfristig ein Renner bleibt und jeweils für ein ausverkauftes Großes Haus sorgen wird.
Weitere Vorstellungen: 10.2., 13.2, 28.2., 11.3., 22.3., 4.4., 26.4.