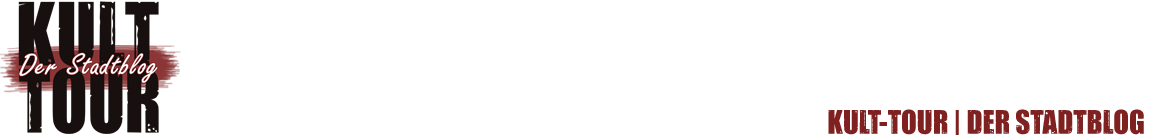Keine Handbreit Wasser drunter. Aus Versehen Kieler Woche.
Kiel, da war ich noch nicht. Also soll dies mein Ziel sein für einen spontanen Tagesausflug: Kiel als Ziel. Drei Stunden Fahrt sind dafür okay. Google Maps zeigt mir, welche Autobahn ich nehmen muss und wo ich nach Parkplätzen Ausschau halten sollte. Auf der Karte sehe ich Hörn, den Keil, den die Ostsee in Kiel treibt, das Ende der Kieler Förde, den Fjord also. Und Kiel ist, wenn ich mehrere Zugdurchfahrten durch Potsdam zählen lasse, die einzige deutsche Landeshauptstadt, die ich noch nicht gesehen habe: Keine Bekannten leben dort, man fährt nicht auf dem Weg woandershin zufällig durch. Also muss es halt als eigenes Ziel herhalten. Die Ostsee, die geht bei mir immer, und in Schleswig, Flensburg und Lübeck hab ich schon schöne Sachen erlebt, wie soll es dann erst in Kiel sein, Landeshauptstadt, hey!
Einen kostenlosen Parkplatz, der zudem nicht wie alle anderen auf nur eine Stunde Parkdauer begrenzt ist, finde ich nach einigem Herumkurven im Norden der Stadt. Dank Google weiß ich, dass sich etwas nördlich des Zentrums ein Aquarium befindet, dahin könnte ich von hier aus auf dem Weg zu Schloss, Altstadt und Hörn einen Abstecher machen. Zufällig ist die Förde von meinem Parkplatz aus nur einen kleinen Parkspaziergang weit entfernt; ich stoße auf die Kiellinie, die Straße, die bis zum Stadtteil mit dem gruftigen Namen Düsternbrook direkt am Meer entlang verläuft. Dahinter folgt ein Stadtteil mit einem sehr sympathischen Namen, Brunswik nämlich, und dazwischen liegt das Aquarium. Feines Vorhaben.
So schlendere ich also die Kiellinie entlang, mich beiläufig wundernd, dass ganz Kiel so erheblich und oft zudem nicht StVO-konform zugeparkt ist. Na, Landeshauptstadt, das muss wohl so sein, man hat ja sonst nix Größeres in Schleswig-Holstein. Auf der Förde kreuzen obskure Behältnisse herum, zwischen Segelschiff und Marinekreuzer; auf der anderen Straßenseite offenbart Kiel die typische Ostseetopographie, es geht steil bergan und ist grün bewachsen. Nur Flensburg ist steiler.
 In der Ferne mache ich ein Riesenrad aus. Cool, Kiel! Hat was von Brighton Pier, was sich die Hauptstädter hier leisten. Wo die Kiellinie in den Düsternbrooker Weg übergeht und dieser einen Schwenk vom Ufer weg macht, weil direkt dort nur Fußgänger und Radfahrer zugelassen sind, stehen Fress- und Saufbuden. Klar, wenn schon Riesenrad, dann auch eine solche Vergnügungsmeile. Das Angebot ist handelsüblich. Cocktails, Fischbrötchen, Kölsch mit entsprechender Schlagermusik, Bratwurst. Verwirrenderweise scheint diese Meile kein Ende zu nehmen. Die müssen es ja nötig haben. Allmählich möchte ich gerne wieder unbedrängt an der Förde spazieren gehen können, aber es reiht sich Nervbude an Nervbude. Ist ja gut! Und warum bieten die an dem einen Stand „Kieler Woche Bier“ an, nur echt ohne Bindestriche? Ah, Moment – nein! Bitte nein. Ich bekomme Angst. Und diese Angst manifestiert sich Schritt um Schritt. Die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten sich: Es ist Kieler Woche. Das hat mir Google beim Googeln verschwiegen, na danke.
In der Ferne mache ich ein Riesenrad aus. Cool, Kiel! Hat was von Brighton Pier, was sich die Hauptstädter hier leisten. Wo die Kiellinie in den Düsternbrooker Weg übergeht und dieser einen Schwenk vom Ufer weg macht, weil direkt dort nur Fußgänger und Radfahrer zugelassen sind, stehen Fress- und Saufbuden. Klar, wenn schon Riesenrad, dann auch eine solche Vergnügungsmeile. Das Angebot ist handelsüblich. Cocktails, Fischbrötchen, Kölsch mit entsprechender Schlagermusik, Bratwurst. Verwirrenderweise scheint diese Meile kein Ende zu nehmen. Die müssen es ja nötig haben. Allmählich möchte ich gerne wieder unbedrängt an der Förde spazieren gehen können, aber es reiht sich Nervbude an Nervbude. Ist ja gut! Und warum bieten die an dem einen Stand „Kieler Woche Bier“ an, nur echt ohne Bindestriche? Ah, Moment – nein! Bitte nein. Ich bekomme Angst. Und diese Angst manifestiert sich Schritt um Schritt. Die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten sich: Es ist Kieler Woche. Das hat mir Google beim Googeln verschwiegen, na danke.
Aber davon haben mir schon manche Leute etwas vorgeschwärmt. Unter der Kieler Woche stellte ich mir immer eine Festivität vor, bei der die Leute gebannt auf den Hafen blicken und lustige Boote betrachten, Hamburger Veermaster und so. Weiße Segel leuchten in der Sonne, wenn sie nicht grad im Wind knattern. Im Ausguck hängen Leute mit Augenklappen und Papagei und knurren lauthals „harrrrr!!!!“. Sowas halt. Aber davon ist hier am Düsternbrooker Weg nichts zu sehen. Zwischen Sylter Fisch und Karibikballerbrühe stehen Minibühnen für Alleinunterhalter mit Marionetten, Kartentricks oder Schlagern, so gestaltet sich das Unterhaltungsprogramm. Das soll also die Kieler Woche sein, der schleswig-holsteinische Publikumsmagnet schlechthin? Die müssen es ja wissen.
Dem unwirtlichen Gedränge entfliehe ich, indem ich mich endlich ins Aquarium Geomar verdrücke. Das kostet mich nur drei Euro Eintritt bei einem freundlichen „Moin“-Sager und bietet mir einen dem Preis angemessenen kleinen Ausstellungsraum mit Ostseefischen in mittelkleinen Becken. Und ein gewisses Maß an Ruhe und Kontemplation, indem ich Katzenhaien, Stachelrochen und Flundern dabei zusehe, wie sie sich in einem bewegten Becken verlustieren. Auch Dorsche, Barsche – ich bekomme Hunger. Ein Blick auf die Uhr ließ mich entsetzt feststellen, dass ich vom Parkplatz bis zum Aquarium eine satte Stunde gebraucht habe. Oha, das wird ein Rückweg, und ich hab den Hörn noch nicht mal erreicht.
Zurück im Gedränge, mache ich einen Fischbrötchenstand aus, der als offenbar einziger keiner Kette angehört, sondern von zwei jungen Frauen aus einem Kieler Verein betrieben wird. Weil die freundliche Kundin vor mir die letzten beiden hausgemachten Matjesbrötchen mitnimmt, bereitet mir eine der Standbetreiberinnen mit einem „Moin“ vorneweg eigens ein frisches für mich zu. Und ja, das schmeckt gut, da steckt das Meer drin, garniert mit Kräutern und Rotem Pfeffer.
Aber ich habe dieses billige Rummelvergnügen, das doch so viel Geld kostet, langsam satt. Gut, dass die Meile kurz vor der Kaistraße endlich endet und es einen Überweg zum Schloss gibt. Raus aus der Kieler Woche. Mein verfrühtes Fazit: Wenn das ein international gefeiertes Spektakel sein soll, verstehe ich das Brimborium nicht. Das ist wie Schützenfest mit Sylter Preisen.
 Im Schlossgarten hat irgendeine Firma einen Kinderspieleparcours aufgebaut. Da haben die Leute also die großen Luftballons her. Und so richtig lässt mich die Kieler Woche also immer noch nicht los. Das Schloss lasse ich links liegen; ich kann sehen, dass es ein kasernenhafter roter Backsteinbau ist, und bin auf die Altstadt vor mir viel neugieriger. Doch was macht Kiel? Stellt lauter Buden vor die Häuser. Die gesamte Altstadt ist angefüllt mit dem, was ich hinter mir gelassen zu haben glaubte. Auf dem Alten Markt grölt eine in den 80ern so genannte Rockröhre drittklassige Rockcoversongs. Die Angebote an den Buden sind jetzt etwas variantenreicher, weil sich zwischen die Ketten auch mal einheimische Vereine drücken, aber die Preise bleiben so unattraktiv wie die Beschallung und im Grunde auch das Angebot. Von einer Altstadt ist nicht nur wegen der Buden kaum etwas zu sehen, die Häuser sind – ganz wie jede Innenstadt der Welt – ebenfalls mit Ketten bestückt. Die Sankt-Nikolai-Kirche bietet nur wenig Eskapismusoption, denn die Band ist auch hier dumpf wummernd wahrzunehmen.
Im Schlossgarten hat irgendeine Firma einen Kinderspieleparcours aufgebaut. Da haben die Leute also die großen Luftballons her. Und so richtig lässt mich die Kieler Woche also immer noch nicht los. Das Schloss lasse ich links liegen; ich kann sehen, dass es ein kasernenhafter roter Backsteinbau ist, und bin auf die Altstadt vor mir viel neugieriger. Doch was macht Kiel? Stellt lauter Buden vor die Häuser. Die gesamte Altstadt ist angefüllt mit dem, was ich hinter mir gelassen zu haben glaubte. Auf dem Alten Markt grölt eine in den 80ern so genannte Rockröhre drittklassige Rockcoversongs. Die Angebote an den Buden sind jetzt etwas variantenreicher, weil sich zwischen die Ketten auch mal einheimische Vereine drücken, aber die Preise bleiben so unattraktiv wie die Beschallung und im Grunde auch das Angebot. Von einer Altstadt ist nicht nur wegen der Buden kaum etwas zu sehen, die Häuser sind – ganz wie jede Innenstadt der Welt – ebenfalls mit Ketten bestückt. Die Sankt-Nikolai-Kirche bietet nur wenig Eskapismusoption, denn die Band ist auch hier dumpf wummernd wahrzunehmen.
Gut. Dann also kein Sightseeing. Ich weiß, dass es etwas südlich einen Plattenladen gibt, „Blitz Records“, in der Hopfenstraße. Die ist lang, und weil ich den Laden irrtümlich nicht auf Höhe des Karstadtmonstrums erwarte, schlendere ich sie einmal herunter und zwangsläufig auch wieder hinauf. Immerhin, ohne Buden links und rechts, aber auch nicht eben mit attraktiver Architektur. Vereinzelt erinnern hübsche Gebäude an maritime Bauweisen, an die Gründerzeit, auch irgendwie an Norddeutschland, aber vieles ist einfach nur 50er-Jahre-nachkriegs-unansehnlich oder postmodern schlichthässlich. Seltsam.
„Blitz Records“ nun ist nicht nur attraktiv bestückt, man empfiehlt mir auf Nachfrage und nach dem obligatorischen „Moin“ zudem eine Kneipe, die wohl etwas alternativer, aber weit im Norden und außerhalb der Innenstadt gelegen ist; der Blick auf mein mobiles Google Maps verrät mir, dass das trotzdem nur der halbe Weg zu meinem Auto ist, also zwangsläufig vertretbar. Vom Vinetaplatz im Stadtteil Gaarden, von dem ich im Internet las, raten sie mir ab: „Der ist nicht einladend“, Gaarden ein „sozialer Brennpunkt“. Nun.
 Ich nähere mich dem Hörn. Und weiß, dass diesen eine Fußgängerbrücke quert, die direkt nach Gaarden führt, das finde ich spannend. Was ich nicht weiß, ist, dass genau dort die nächste Fressmeile beginnt. Zwischen dieser und der nördlich gelegenen Altstadt versperren große Fährlinien mit noch größeren Schiffen den direkten Zugang zur Förde, aber am Hörn tobt wieder die Sprotte. Am anderen Ufer, also schon in Gaarden, kreischen sich die Jugendlichen in Rummelplatzfahrgeschäften die Seele aus dem alkoholdurchtränkten Leib. Auch am Hauptbahnhof plärrt irgendwer irgendwas von einer Bühne, Rock-Covers im Jazz-Sound dieses Mal. Ich will weg. Doch die Hörnbrücke ist gerade hochgeklappt, weil sie so flach über das Wasser führt, dass Schiffe dort nicht drunter durch passen, wenn sie sich trotzdem in das Ende der Bucht vor die Zuschauertribüne quetschen wollen. Gerade erlebe ich also das die Querung verhindernde Klappspektakel, und ich würde mir die vorbeiziehenden Boote auch gerne genauer ansehen, doch ist die Schlange vor der Brücke ausufernd lang und plärren hinter mir einige ambitionierte junge Männer irgendwelche Hip-Hop-Reime zu schlecht geloopten Samples. Dann nehme ich eben den Weg rund um den Hörn auf mich, weiter durch die nächste Budenzeile. So ein betoniertes Fördeende mit Sitzplätzen kenne ich bereits aus Flensburg, ganz nett, und dieses hier scheint sogar etwas größer zu sein als der Komplementär im Norden. Hier sitzen jetzt allerdings besoffene Jugendliche und freuen sich über abscheulich schmeckende Wodkamixgetränke, die hinter ihnen an geschmacklich ähnlich beschallten und gestalteten Ständen feilgeboten werden. Es wird nicht besser. Immerhin, als kleiner Gag schippert irgendwer mit einem Campinganhänger übers Wasser. Also gibt es doch latente maritime Themen bei der Kieler Woche.
Ich nähere mich dem Hörn. Und weiß, dass diesen eine Fußgängerbrücke quert, die direkt nach Gaarden führt, das finde ich spannend. Was ich nicht weiß, ist, dass genau dort die nächste Fressmeile beginnt. Zwischen dieser und der nördlich gelegenen Altstadt versperren große Fährlinien mit noch größeren Schiffen den direkten Zugang zur Förde, aber am Hörn tobt wieder die Sprotte. Am anderen Ufer, also schon in Gaarden, kreischen sich die Jugendlichen in Rummelplatzfahrgeschäften die Seele aus dem alkoholdurchtränkten Leib. Auch am Hauptbahnhof plärrt irgendwer irgendwas von einer Bühne, Rock-Covers im Jazz-Sound dieses Mal. Ich will weg. Doch die Hörnbrücke ist gerade hochgeklappt, weil sie so flach über das Wasser führt, dass Schiffe dort nicht drunter durch passen, wenn sie sich trotzdem in das Ende der Bucht vor die Zuschauertribüne quetschen wollen. Gerade erlebe ich also das die Querung verhindernde Klappspektakel, und ich würde mir die vorbeiziehenden Boote auch gerne genauer ansehen, doch ist die Schlange vor der Brücke ausufernd lang und plärren hinter mir einige ambitionierte junge Männer irgendwelche Hip-Hop-Reime zu schlecht geloopten Samples. Dann nehme ich eben den Weg rund um den Hörn auf mich, weiter durch die nächste Budenzeile. So ein betoniertes Fördeende mit Sitzplätzen kenne ich bereits aus Flensburg, ganz nett, und dieses hier scheint sogar etwas größer zu sein als der Komplementär im Norden. Hier sitzen jetzt allerdings besoffene Jugendliche und freuen sich über abscheulich schmeckende Wodkamixgetränke, die hinter ihnen an geschmacklich ähnlich beschallten und gestalteten Ständen feilgeboten werden. Es wird nicht besser. Immerhin, als kleiner Gag schippert irgendwer mit einem Campinganhänger übers Wasser. Also gibt es doch latente maritime Themen bei der Kieler Woche.
Am Ende der Kaistraße habe ich die Wahl, mich weiter durch die Kieler Woche zu schlagen, um das andere Ende der Hörnbrücke zu erreichen, oder mich der freundlichen Empfehlung aus dem Plattenladen zu widersetzen und ein bisschen durch Gaarden zu schlendern. Ich entscheide mich für Letzteres. Schlimmer geht’s nimmer. Geht es auch nicht, aber rein optisch hatten die Tonträgerdistributoren schon Recht, Gaarden ist nicht sonderlich einladend. So verpasse ich den Vinetaplatz nur um eine Parallelstraßenbreite und erreiche über den Pastor-Gosch-Weg die Gaardener Brücke, die irgendwo oberhalb einer Baustelle abrupt endet und den Fußgänger seinen weiteren Weg durch unerforschte Wildnis suchen lässt, und so letztlich doch noch die Hörnbrücke, abermals empfangen von Dröhngeschäften und Bedröhnten. Die Hörnbrücke ist aber wirklich eindrucksvoll. Aus Holz, eben klappbar, jetzt ausgestreckt, gottlob, führt sie vom Germaniahafen in Richtung Bahnhof, vorbei an der riesigen Color-Line-Abfertigung, einem ankernden Sovielmaster, dass ich nicht in der Lage bin, seine vielen Masten zu zählen, und mit Blick auf das, von dem ich in meiner unbedarften Naivität dachte, dass es bei der Kieler Woche die Hauptattraktion sei, nämlich Schiffen aller Art. Aber vor lauter Geschiebe komme ich kaum zum Verweilen und Inaugenscheinnehmen.
 Also weg. Zurück in die Altstadt, aber vorher links abgebogen, am Rathaus und am Landesparlament vorbei, etwas Sightseeing will ich mir noch geben, doch die Kieler Woche verwehrt mir diesen Wunsch auch hier. Noch mehr Bühnen, Buden, Ballermann. Es gibt einen „Internationalen Markt“, der mit Bier aus Australien und Polen beginnt, zunächst also einigermaßen einladend erscheint, letztlich aber auch nur vollgepropft ist mit Kinderwagen, Fahrrädern, Trinkergruppen und anderen Schikanen. Ich will nicht mehr. Eigentlich plagen mich Hunger und die Bereitschaft, sogar an einem der Stände Geld zu lassen, doch keiner davon schreit lauthals „hier!“.
Also weg. Zurück in die Altstadt, aber vorher links abgebogen, am Rathaus und am Landesparlament vorbei, etwas Sightseeing will ich mir noch geben, doch die Kieler Woche verwehrt mir diesen Wunsch auch hier. Noch mehr Bühnen, Buden, Ballermann. Es gibt einen „Internationalen Markt“, der mit Bier aus Australien und Polen beginnt, zunächst also einigermaßen einladend erscheint, letztlich aber auch nur vollgepropft ist mit Kinderwagen, Fahrrädern, Trinkergruppen und anderen Schikanen. Ich will nicht mehr. Eigentlich plagen mich Hunger und die Bereitschaft, sogar an einem der Stände Geld zu lassen, doch keiner davon schreit lauthals „hier!“.
Im angrenzenden Hiroshimapark mit Aussicht auf den Teich namens „Kleiner Kiel“ gönne ich mir eine Pause unter einem Baum, der mich vor den vereinzelten schweren Regentropfen schützt. Luft holen, Füße schonen für den langen Weg zur Palenke, der empfohlenen Kneipe. „Da steht ein Motorrad im Fenster“, lautete vorhin einer der Pluspunkte. Nun denn. Eine halbe Stunde dauert die Strecke, die Gerhardstraße entlang, parallel zur Holtenauer Straße, „die kennt hier jeder“, so die Info bei „Blitz Records“. Und tatsächlich, die Palenke an der Ecke zur Wrangelstraße versöhnt mich mit Kiel.
Drinnen ist es eng, schummrig, vollgestellt, Theke und Nischen sind besetzt, und draußen stehen an der Straßenecke auch ein paar Tische. Dort nehme ich Platz und komme nach einem „Moin“ mit dem Gastronomen ins Gespräch. Die Kieler Woche habe sich verschlechtert, weiß der Mann, besonders schlimm sei der Teil an der Kiellinie, nur reiche Sylter, Schickimicki, viel zu teuer. Das war mein zufälliger Anfang, aber ich wäre nicht der Meinung gewesen, dass es sich in der Folge signifikant verbessert hätte. Oktoberfest mit Schiffen; nicht anders, nur größer als jedes handelsübliche Altstadtfest anderswo. Aber ich gebe zu, dass ich nicht das Zielpublikum für derlei Festivitäten bin, mich lockt auch das Braunschweiger Magnifest nicht an. Ja, Geschmackssache, klar, aber meinen trifft es eben nicht.
Dafür stelle ich erfreut fest, dass in dieser Gegend Kiels nicht nur die Passanten, sondern auch die Häuser wieder ansehnlich sind. „Blücher halt, Studenten“, sagt der Gastronom schulterzuckend und Fragen aufwerfend. „Gehst du hier links in die Holtenauer Straße, sieht es schon wieder ganz anders aus.“ Wir plaudern eine Weile, wenn er nicht gerade die anderen Gäste bedient, und damit widerspricht er dem Slogan der Palenke, der da sagt: „Cold Food – Warm Beer – Lousy Service“. Auch die ersten beiden Punkte treffen nicht zu. In der Speisenkarte, offiziell mit N in der Mitte, steht, dass man mit üppigem Trinkgeld die Bedienung zwar glücklicher mache, den Service aber nicht besser. Was soll ich sagen: Das geht ja auch kaum, der ist gut.
 Bis zu meinem Auto sind es weitere 20 Minuten Fußweg, dieses Mal nehme ich den durch „Blücher“, das Studentenviertel an der Blücherstraße, und stelle fest, dass es hier tatsächlich wohnlich aussieht: bunt, freundlich, mit Graffiti, Tags und Stickern dekoriert. Und doch, ich muss hier raus, weiter nach Norden, vielleicht noch einmal irgendwo die Hand in die Ostsee halten. Gar nicht so einfach: Der Nord-Ostsee-Kanal versperrt den Weg. Zufällig lande ich an der Aussichtsplattform und sehe dabei zu, wie ein gigantischer Güterkahn namens „Duisburg“ geschleust wird. Ich muss letztlich doch die Hochbrücke queren, um endlich in Friedrichsort den verwinkelten Weg an den Strand zu finden. Die Dämmerung setzt ein, so kurz nach Sommersonnenwende erfreulich spät. Auf einem Steg beobachte ich einen Mehrmaster sich langsam und partyfröhlich tönend Kiel nähern. Im flachen Wasser unter mir jagen sich die Strandkrabben. Ein Angler wirft seine Rute ins Meer. Die Wellen plätschern seicht an den Sandstrand. Der Himmel trägt sein sommerliches Indigo, der Wind ist überraschend warm, das Meer verströmt seinen wohlig-fischigen Geruch. Warum nicht gleich so. Hier hat’s mehr als eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Bis zu meinem Auto sind es weitere 20 Minuten Fußweg, dieses Mal nehme ich den durch „Blücher“, das Studentenviertel an der Blücherstraße, und stelle fest, dass es hier tatsächlich wohnlich aussieht: bunt, freundlich, mit Graffiti, Tags und Stickern dekoriert. Und doch, ich muss hier raus, weiter nach Norden, vielleicht noch einmal irgendwo die Hand in die Ostsee halten. Gar nicht so einfach: Der Nord-Ostsee-Kanal versperrt den Weg. Zufällig lande ich an der Aussichtsplattform und sehe dabei zu, wie ein gigantischer Güterkahn namens „Duisburg“ geschleust wird. Ich muss letztlich doch die Hochbrücke queren, um endlich in Friedrichsort den verwinkelten Weg an den Strand zu finden. Die Dämmerung setzt ein, so kurz nach Sommersonnenwende erfreulich spät. Auf einem Steg beobachte ich einen Mehrmaster sich langsam und partyfröhlich tönend Kiel nähern. Im flachen Wasser unter mir jagen sich die Strandkrabben. Ein Angler wirft seine Rute ins Meer. Die Wellen plätschern seicht an den Sandstrand. Der Himmel trägt sein sommerliches Indigo, der Wind ist überraschend warm, das Meer verströmt seinen wohlig-fischigen Geruch. Warum nicht gleich so. Hier hat’s mehr als eine Handbreit Wasser unterm Kiel.