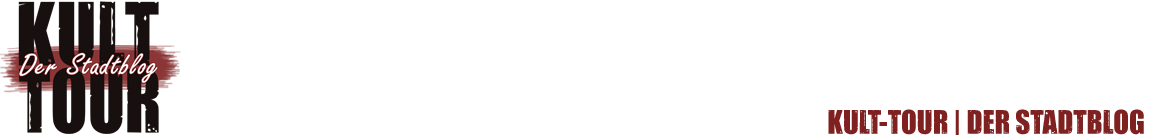Als mein Opa vom Töten erzählte
Krasser Titel, denkt ihr. Und das auch noch zur Vorweihnachtszeit? Ähnliches denke ich auch, als ich mir das Thema des Theaterstücks „Kriegsenkel“ vergegenwärtige. Wie sollen wir als Enkel und Enkelinnen mit der Kriegsvergangenheit unserer Großeltern umgehen? Wie kommt man ins Gespräch über das Unaussprechliche? Die nicht ganz leichte Fragestellung des Theaterstücks wird hier mit einer effektvollen aber doch minimalistischen Vermengung von Tanz, Schauspiel, Wort, Musik, Lichttechnik und Foto-/Videoprojektion auf die Bühne gebracht. „Kriegsenkel“ entwickelt so eine erstaunliche Sogwirkung und beeindruckt mich tief bei meinem Besuch am Freitag, den 18.12.2015.
 Als ich als erste den Vorführraum im Studio A der Kunstmühle betrete, wird mir in Hinblick auf die Thematik des Stücks ganz plötzlich klar, was eigentlich am schwersten zu bewältigen ist: Das Schweigen um die Kriegserlebnisse unserer Großeltern. Die vier Darsteller sind auf der Bühne starr drapiert und nur der Tontechniker reagiert, als ich den Raum betrete. Die Stille und Bewegungslosigkeit der Schauspieler ist beklemmend. So nähert man sich doch als soziales Wesen dem Gegenüber mittels Gestik, Mimik und vor allem auf konversativer Ebene. Dies alles wird mir verwehrt und mit einem irritierten Gefühl in Kopf und Magengrube wähle ich mir einen Platz. Als die restlichen Besucher eintreten, kommt bald auch Bewegung in die Figuren auf der Bühne. Gleichzeitig körperschmeichelnd und doch irgendwie unbeholfen wandeln die Schauspieler endlich auf das Publikum zu. Das erste Wort wirkt wie eine scharfe Zäsur durch die Stille. Brutal, aber doch befreiend. Dennoch vermitteln die gesprochenen Sätze, Ellipsen, Lautmalereien in „Kriegsenkel“ anfangs vielmehr die Sprachlosigkeit. „Äh“ und „Aber“ und „Wie“ und „Warum“ – die Worte wollen nicht recht über die Lippen kommen und die Darsteller winden sich nicht nur verbal, sondern kämpfen auch mittels ihrer Tanzbewegungen auf der Suche nach dem richtigen Weg.
Als ich als erste den Vorführraum im Studio A der Kunstmühle betrete, wird mir in Hinblick auf die Thematik des Stücks ganz plötzlich klar, was eigentlich am schwersten zu bewältigen ist: Das Schweigen um die Kriegserlebnisse unserer Großeltern. Die vier Darsteller sind auf der Bühne starr drapiert und nur der Tontechniker reagiert, als ich den Raum betrete. Die Stille und Bewegungslosigkeit der Schauspieler ist beklemmend. So nähert man sich doch als soziales Wesen dem Gegenüber mittels Gestik, Mimik und vor allem auf konversativer Ebene. Dies alles wird mir verwehrt und mit einem irritierten Gefühl in Kopf und Magengrube wähle ich mir einen Platz. Als die restlichen Besucher eintreten, kommt bald auch Bewegung in die Figuren auf der Bühne. Gleichzeitig körperschmeichelnd und doch irgendwie unbeholfen wandeln die Schauspieler endlich auf das Publikum zu. Das erste Wort wirkt wie eine scharfe Zäsur durch die Stille. Brutal, aber doch befreiend. Dennoch vermitteln die gesprochenen Sätze, Ellipsen, Lautmalereien in „Kriegsenkel“ anfangs vielmehr die Sprachlosigkeit. „Äh“ und „Aber“ und „Wie“ und „Warum“ – die Worte wollen nicht recht über die Lippen kommen und die Darsteller winden sich nicht nur verbal, sondern kämpfen auch mittels ihrer Tanzbewegungen auf der Suche nach dem richtigen Weg.  „Kriegsenkel“ ist ein Stück der Widersprüche. Witze aus alter Zeit treffen auf bedrückende Kriegsberichte. Fröhliche Tanzeinlagen zu altmodischer Musik wechseln sich ab mit qualvollen Bewegungen zu tragenden Klavierklängen. Oftmals steigern sich die Tänzer ins nahezu Hysterische und rennen letztendlich immer wieder buchstäblich und im übertragenen Sinne gegen die Wand. Geschichtsbücher werden zur Hand genommen, doch die Beschreibungen bringen nicht das erhoffte Verständnis des Geschehens während des Zweiten Weltkriegs. Wie ein roter Faden werden daher immer wieder persönliche Beschreibungen der eigenen Großeltern in das rund 75 Minuten dauernde Theaterstück eingeflochten, begleitet von Foto- und Videoprojektionen aus alter und neuerer Zeit. Während die Hitlerjugend in schwarz-weiß über die Leinwände turnt und marschiert, kommen die jungen Darsteller davor sichtlich ins Schwitzen. Hart atmend verknoten sich die Körper, sie stützen und halten sich gegenseitig in ihrem Schmerz, um dann wieder auseinanderzusprengen und mit weit aufgerissenen Augen in vor Entsetzen verzerrten Gesichtern über die Bühne zu wandeln und zu rennen. Im wunderschönen und gekonnt eingesetzten Bühnenlicht tanzen die Schatten mit. Sind das die Schatten der Vergangenheit? Ihre Magie berührt auch uns, die im Publikum das Geschehen gespannt miterleben dürfen. Auch in uns lebt die Vergangenheit weiter.
„Kriegsenkel“ ist ein Stück der Widersprüche. Witze aus alter Zeit treffen auf bedrückende Kriegsberichte. Fröhliche Tanzeinlagen zu altmodischer Musik wechseln sich ab mit qualvollen Bewegungen zu tragenden Klavierklängen. Oftmals steigern sich die Tänzer ins nahezu Hysterische und rennen letztendlich immer wieder buchstäblich und im übertragenen Sinne gegen die Wand. Geschichtsbücher werden zur Hand genommen, doch die Beschreibungen bringen nicht das erhoffte Verständnis des Geschehens während des Zweiten Weltkriegs. Wie ein roter Faden werden daher immer wieder persönliche Beschreibungen der eigenen Großeltern in das rund 75 Minuten dauernde Theaterstück eingeflochten, begleitet von Foto- und Videoprojektionen aus alter und neuerer Zeit. Während die Hitlerjugend in schwarz-weiß über die Leinwände turnt und marschiert, kommen die jungen Darsteller davor sichtlich ins Schwitzen. Hart atmend verknoten sich die Körper, sie stützen und halten sich gegenseitig in ihrem Schmerz, um dann wieder auseinanderzusprengen und mit weit aufgerissenen Augen in vor Entsetzen verzerrten Gesichtern über die Bühne zu wandeln und zu rennen. Im wunderschönen und gekonnt eingesetzten Bühnenlicht tanzen die Schatten mit. Sind das die Schatten der Vergangenheit? Ihre Magie berührt auch uns, die im Publikum das Geschehen gespannt miterleben dürfen. Auch in uns lebt die Vergangenheit weiter.
 Dann formulieren sich ganz unvermittelt konkrete und drängende Fragen: „Sag‘ Oma, bist du sicher, dass dein jüdischer Mitschüler wirklich so plötzlich verreist war?“ Die Antwort bleibt aus. Stattdessen wird immer wieder eine unbefriedigende Antwort eingespielt: „Wir haben das nicht gewusst.“, „Wir wussten doch von nichts“. Ich erkenne die Stimmen der Großeltern in den Tonaufnahmen. Sie haben offenbar etwas mit uns gemeinsam: Die Sprachlosigkeit angesichts der realen Geschehnisse. Die Sprachlosigkeit vor dem eigenen Handeln? Doch die Vergangenheit ist real und lässt sich schwer verschweigen, das verdeutlicht auch das Theaterstück sehr nachdrücklich. Zum Bespiel werden mithilfe eines schlichten Schranks schwerwiegende Assoziationen geweckt. Der Schrank wird in meinem Kopf zur Gaskammer und gleichzeitig zum Sarg. Im Inneren windet sich hinter durchscheinendem Stoff ein Mensch. Der Stoff trennt dieses fremde Wesen von unserer Sphäre. Trotzdem können wir es sehen und es ist fast unmöglich wegzuschauen. Ist es tot oder lebendig? In manch‘ gruseligem Moment in „Kriegsenkel“ vermengen sich symbolisch das Tote und das Lebendige, doch für mich appelliert das Stück dennoch an das Leben. Nie rutscht es in die Unerträglichkeit ab, die im bedrohlichen Kern der Thematik schlummert. Die Darsteller finden einen Weg, die Fragestellung auf künstlerisch anspruchsvolle und doch für den Zuschauer sehr zugängliche Art und Weise aufzuarbeiten. Schlussendlich wird selbstverständlich kein Geheimrezept enthüllt, wie man mit der Vergangenheit der eigenen Großeltern umgehen soll. Schließlich geht es hier um Menschen und um ganz unterschiedliche, individuelle Erfahrungen. Eine zentrale Aussage in „Kriegsenkel“ wirkt auf mich jedoch wie ein Appel: „Das sind keine Fremden, das sind deine Großeltern“. Ja, das Fremde ist vor allem die Kriegserfahrung, die wir nicht gelebt mit ihnen teilen können, und das wirkt wie eine unüberwindliche Grenze. Doch wir können darüber sprechen und das sollten wir meiner Meinung nach auch tun, so lange wir es noch können. So lange unsere Großeltern noch leben.
Dann formulieren sich ganz unvermittelt konkrete und drängende Fragen: „Sag‘ Oma, bist du sicher, dass dein jüdischer Mitschüler wirklich so plötzlich verreist war?“ Die Antwort bleibt aus. Stattdessen wird immer wieder eine unbefriedigende Antwort eingespielt: „Wir haben das nicht gewusst.“, „Wir wussten doch von nichts“. Ich erkenne die Stimmen der Großeltern in den Tonaufnahmen. Sie haben offenbar etwas mit uns gemeinsam: Die Sprachlosigkeit angesichts der realen Geschehnisse. Die Sprachlosigkeit vor dem eigenen Handeln? Doch die Vergangenheit ist real und lässt sich schwer verschweigen, das verdeutlicht auch das Theaterstück sehr nachdrücklich. Zum Bespiel werden mithilfe eines schlichten Schranks schwerwiegende Assoziationen geweckt. Der Schrank wird in meinem Kopf zur Gaskammer und gleichzeitig zum Sarg. Im Inneren windet sich hinter durchscheinendem Stoff ein Mensch. Der Stoff trennt dieses fremde Wesen von unserer Sphäre. Trotzdem können wir es sehen und es ist fast unmöglich wegzuschauen. Ist es tot oder lebendig? In manch‘ gruseligem Moment in „Kriegsenkel“ vermengen sich symbolisch das Tote und das Lebendige, doch für mich appelliert das Stück dennoch an das Leben. Nie rutscht es in die Unerträglichkeit ab, die im bedrohlichen Kern der Thematik schlummert. Die Darsteller finden einen Weg, die Fragestellung auf künstlerisch anspruchsvolle und doch für den Zuschauer sehr zugängliche Art und Weise aufzuarbeiten. Schlussendlich wird selbstverständlich kein Geheimrezept enthüllt, wie man mit der Vergangenheit der eigenen Großeltern umgehen soll. Schließlich geht es hier um Menschen und um ganz unterschiedliche, individuelle Erfahrungen. Eine zentrale Aussage in „Kriegsenkel“ wirkt auf mich jedoch wie ein Appel: „Das sind keine Fremden, das sind deine Großeltern“. Ja, das Fremde ist vor allem die Kriegserfahrung, die wir nicht gelebt mit ihnen teilen können, und das wirkt wie eine unüberwindliche Grenze. Doch wir können darüber sprechen und das sollten wir meiner Meinung nach auch tun, so lange wir es noch können. So lange unsere Großeltern noch leben.
 Mein Opa ist zum Beispiel in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden, das bedeutet, dass er als junger Erwachsener sehr viel vom Krieg miterlebt hat. Ja, er war auch Soldat. Wenn er über den Krieg erzählt, dann sind es oft die gleichen Geschichten. Meistens überwiegt das Alltägliche in seinen Worten und Tod und Verderben bleibt manchmal weitestgehend außen vor oder wirken auch alltäglich. Trotzdem denke ich meistens den Schrecken mit, der mir aus Bildern und Fakten aus Geschichtsbüchern, Dokumentationen und meinem Studium nur zu gut bekannt ist. Grundsätzlich klafft dann aber eine Schere in meinem Kopf auseinander. Auf der einen Seite steht dieses theoretische Wissen um die Greueltaten der Deutschen, auf der anderen steht mein mir vertrauter Opa, der vor mir sitzt und erzählt. Und dann schweife ich sogar manchmal gedanklich ab, finde keinen Zugang zu dem Erzählten. Und dann – dann gab es einmal diesen Moment, als wir ziemlich lange zusammen saßen und die Situation sehr entspannt war. Vielleicht war er auch entspannt und das war der Grund, denn plötzlich fand er konkrete Worte und erzählte mir detailliert von einer Situation, als er einen kriegerischen Gegner erschießen musste. Natürlich war dieser Moment ein Schock, aber in diesem Moment wurde der Krieg für mich tatsächlich greifbarer, denn mein Opa ist mir als Mensch in diesem Moment näher gerückt. Viel schlimmer war vorher das dunkel-ahnende Wissen, dass er Menschen getötet haben muss, dies es aber nie so konkret ausgesprochen hat. Und so schlimm diese Vorstellung auch ist, denn irgendwo auf dieser Welt gibt es vielleicht einen Enkel oder eine Enkelin, die durch den tödlichen Schuss meines Opas den Großvater verloren hat, ist mir auf erschreckende Weise klar geworden, dass dem Tod des anderen auch der Moment des Lebens innewohnt: Denn nur weil mein Opa geschossen hat, konnte er mir das erzählen. Und während ich hier um passende Worte ringen, um diese Situation und auch diese Tat meines Opas zu erklären, formulierte er selbst eine ganz einfache Antwort, während ich stille Trauer in seinen Augen warhnahm: „Ich musst schießen, sonst hätte er es getan.“
Mein Opa ist zum Beispiel in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden, das bedeutet, dass er als junger Erwachsener sehr viel vom Krieg miterlebt hat. Ja, er war auch Soldat. Wenn er über den Krieg erzählt, dann sind es oft die gleichen Geschichten. Meistens überwiegt das Alltägliche in seinen Worten und Tod und Verderben bleibt manchmal weitestgehend außen vor oder wirken auch alltäglich. Trotzdem denke ich meistens den Schrecken mit, der mir aus Bildern und Fakten aus Geschichtsbüchern, Dokumentationen und meinem Studium nur zu gut bekannt ist. Grundsätzlich klafft dann aber eine Schere in meinem Kopf auseinander. Auf der einen Seite steht dieses theoretische Wissen um die Greueltaten der Deutschen, auf der anderen steht mein mir vertrauter Opa, der vor mir sitzt und erzählt. Und dann schweife ich sogar manchmal gedanklich ab, finde keinen Zugang zu dem Erzählten. Und dann – dann gab es einmal diesen Moment, als wir ziemlich lange zusammen saßen und die Situation sehr entspannt war. Vielleicht war er auch entspannt und das war der Grund, denn plötzlich fand er konkrete Worte und erzählte mir detailliert von einer Situation, als er einen kriegerischen Gegner erschießen musste. Natürlich war dieser Moment ein Schock, aber in diesem Moment wurde der Krieg für mich tatsächlich greifbarer, denn mein Opa ist mir als Mensch in diesem Moment näher gerückt. Viel schlimmer war vorher das dunkel-ahnende Wissen, dass er Menschen getötet haben muss, dies es aber nie so konkret ausgesprochen hat. Und so schlimm diese Vorstellung auch ist, denn irgendwo auf dieser Welt gibt es vielleicht einen Enkel oder eine Enkelin, die durch den tödlichen Schuss meines Opas den Großvater verloren hat, ist mir auf erschreckende Weise klar geworden, dass dem Tod des anderen auch der Moment des Lebens innewohnt: Denn nur weil mein Opa geschossen hat, konnte er mir das erzählen. Und während ich hier um passende Worte ringen, um diese Situation und auch diese Tat meines Opas zu erklären, formulierte er selbst eine ganz einfache Antwort, während ich stille Trauer in seinen Augen warhnahm: „Ich musst schießen, sonst hätte er es getan.“
Agnetha Jaunich: „Kriegsenkel“
HEUTE zweite und letzte Vorstellung: Kunstmühle Studio A | Hannoversche Straße 69 | 19. Dezember 2015 um 19 Uhr | Eintritt 12,-E/ erm. 5,-E | FB-EVENT
Text und Fotos: Stefanie Krause